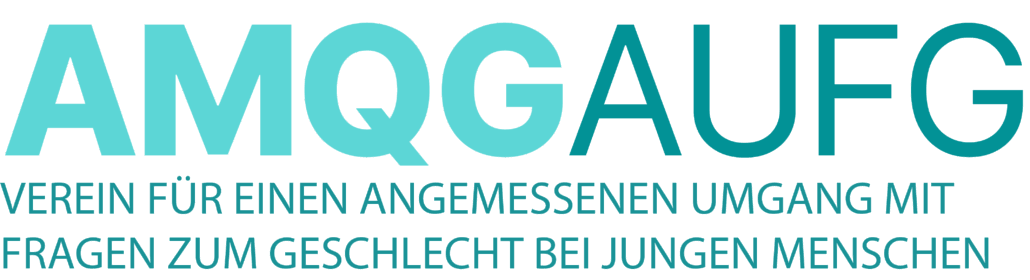Studien zur psychischen Gesundheit und zum Suizidrisiko bei trans-identifizierenden / „nicht-binären“ Jugendlichen verstehen
Studien zur psychischen Gesundheit und zum Suizidrisiko bei trans-identifizierenden / "nicht-binären" Jugendlichen verstehen
Es gibt zahlreiche Studien über transidentifzierende oder „nicht-binäre“ Jugendliche und das Risiko von Suizidgedanken, Suizidversuchen oder Depressionen. Es gibt jedoch wichtige Einschränkungen: Die Zahlen müssen mit Vorsicht interpretiert werden.
1) Wie Studien durchgeführt werden
- Selbstberichtete Fragebögen: Viele Studien fragen Jugendliche, ob sie Suizidgedanken oder Suizidversuche hatten. Vorteil: grosse Abdeckung. Einschränkung: Was der Jugendliche angibt, kann je nach Kontext und Erinnerung variieren.
- Krankenakten / Krankenhausaufenthalte: Einige Studien verwenden dokumentierte Suizidversuche oder Einweisungen wegen Selbstverletzung. Vorteil: objektive Daten. Einschränkung: Berücksichtigt keine nicht gemeldeten Suizidgedanken und erfasst nur das, was in Krankenhäusern behandelt wird.
- Mortalitätsregister: Ermöglichen die Messung von Suiziden, dies ist jedoch bei diesen Populationen in grossem Maßstab selten. Die Zahlen existieren hauptsächlich in bestimmten Ländern (z.B. Skandinavien), bleiben aber gering und unsicher.
2) Die wichtigsten Verzerrungen und Einschränkungen
- Nicht-repräsentative Stichproben: Viele Studien stammen aus klinischen oder gemeinschaftlichen Stichproben (LGBTQ+-Netzwerke), was Jugendliche in Not überrepräsentiert.
- Unterschiedliche Massnahmen je nach Studien : Definition von « trans », « nicht-binär », Untersuchungszeitraum, Arten von Fragen zu Selbstmordgedanken oder -versuchen… → schwierig, die Zahlen zu vergleichen.
- Querschnittsstudien: Machen „eine Momentaufnahme“ zu einem bestimmten Zeitpunkt, daher kann keine Kausalität hergestellt werden (z.B. Stigmatisierung → Suizidrisiko).
- Daten zu Detransition und chirurgischem Bedauern: Kurze oder unterbrochene Nachbeobachtungen, Verluste in der Nachverfolgung. Die bekannten Raten (~1 % für chirurgisches Bedauern) sind nicht generalisierbar, und die tatsächliche Detransitionsrate ist unbekannt und könnte in den kommenden Jahren steigen.
- Politisierung des Themas: Einige Studien mit spektakulären Ergebnissen erregen mehr Aufmerksamkeit als nuancierte Studien.
3) Suizidgedanken vs. tatsächliche Suizidversuche
- Suizidgedanken: Hauptsächlich von Jugendlichen selbst berichtet. Dies weist auf ihr Leid hin, ist aber nicht dasselbe wie ein Suizidversuch.
- Suizidversuche: Einige werden selbst berichtet, andere sind in Krankenhäusern dokumentiert. Die Zahlen variieren je nach Methode.
- Suizidtodesfälle: Sehr selten in Registern und bei TGD-Jugendlichen schwer präzise zu messen.
4) Detransition / chirurgisches Bedauern
- Bedauern nach Operation: Niedrige Rate (~1 %), aber begrenzte Studien und hauptsächlich an operierten Erwachsenen. Wenig verlässliche Informationen über Jugendliche oder solche, die nur mit Hormonen behandelt werden.
- Soziale oder medizinische Detransition: Prävalenz unbekannt, heterogene Studien, variable Definitionen.
5) Praktische Empfehlungen für Eltern
- Dem Leid zuhören und es ernst nehmen: Suizidgedanken sind ein wichtiges Signal.
- Vorsicht vor irreversiblen Eingriffen: Zuerst psychologische und soziale Unterstützung bevorzugen.
- An veränderbaren Faktoren arbeiten: familiäre Unterstützung, Reduzierung von Stigmatisierung, Raum zur Identitätsfindung.
Diese Faktoren verringern das Suizidrisiko erheblich.
Wichtige Referenzen:
- Russell ST, Pollitt AM, Li G, Grossman AH. Chosen Name Use Is Linked to Reduced Depressive Symptoms, Suicidal Ideation, and Suicidal Behavior Among Transgender Youth. J Adolesc Health. 2018;63(4):503-505. PubMed
- Thoma BC, et al. Suicidality disparities among transgender youth: Risk and protective factors. J Adolesc. 2019;74:82-97. PubMed
- Olson KR, et al. Mental health of transgender children who are supported in their identities. Pediatrics. 2016;137(3):e20153223. PubMed
This post is also available in: Français (Französisch)

 Zensur, Misogynie, Verstümmelung von Minderjährigen… Homosexuelle prangern...
Zensur, Misogynie, Verstümmelung von Minderjährigen… Homosexuelle prangern...